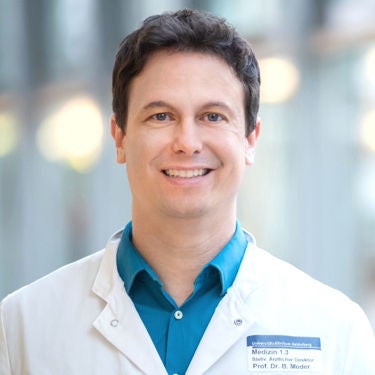Laut ESC-Leitlinien ist für die Diagnose grundsätzlich ein multimodaler bzw. multiparametrischer Ansatz zu verwenden, der unterschiedliche Untersuchungen einschließt, um die komplexen kausalen und phänotypischen Faktoren einer Kardiomyopathie zu erfassen. Die Leitlinien empfehlen einen diagnostischen Pathway mit den genannten Untersuchungen in folgende Reihenfolge: Anamnese, körperliche Untersuchung, EKG, Echokardiographie, Labor, kardiale MRT, Szintigraphie, Myokardbiopsie und genetische Testung.
Obwohl die Diagnose der Kardiomyopathie in erster Linie anhand der phänotypischen Präsentation gestellt wird, wurde der Stellenwert von Gentestungen in den letzten Jahren deutlich aufgewertet. So sollen genetische Testungen nicht nur zur Diagnosesicherung, sondern auch für das Familienscreening eingesetzt werden. Weiterhin sind Gentests hilfreich zur Abklärung von Grenzfällen oder von genetischen Modifikationen, die eine Kardiomyopathie imitieren können.
Die ESC-Leitlinien empfehlen Gentests bei Patientinnen und -Patienten, die die diagnostischen Kriterien für eine Kardiomyopathie erfüllen, falls dadurch die Diagnose, Prognose, therapeutische Stratifizierung oder das Reproduktionsmanagement ermöglicht wird, oder falls die Gentests eine kaskadierende genetische Evaluation von Verwandten erlauben, die ansonsten an einem Langzeitmonitoring teilnehmen müssten (IB-Empfehlung). Auch post mortem kann eine genetische Untersuchung erfolgen, falls die Behandlung der hinterbliebenen Angehörigen verbessert werden kann (IC-Empfehlungen).