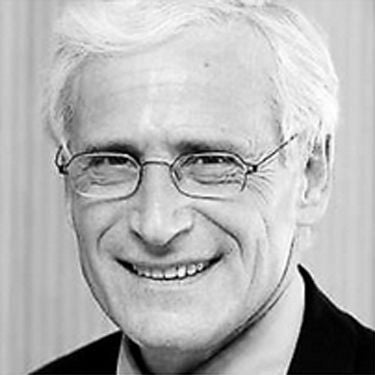de Haan: Welche Rolle spielen Erfahrung des Untersuchenden und Equipment?
Cribier: Aufgrund langjähriger Erfahrung bei der Patientenselektion, aber auch verbesserter Bildgebung und verbessertem Prothesen und Einführbesteckmaterial hat TAVI diese positive Entwicklung genommen. Über die Femoralarterie wird heute in der Regel mit einem 14-F-Katheter begonnen – statt einem 24-F-Katheter in der Anfangszeit. Es gibt eine breite Palette an Prothesentypen und -größen. Die Rate ernster Komplikationen beträgt 1–2 %. Mein Team und ich veranstalten regelmäßig Trainingskurse.
de Haan: Es gibt drei Hauptprobleme bei der TAVI: bikuspide Aortenklappen, besonders wenn sie verkalkt sind, Randleck (PVL) und die Indikation für einen Herzschrittmacher (SM), oder?
Cribier: Nach über 20-jähriger Erfahrung mit TAVI wissen wir, dass die Klappenanatomie keine besonderen Probleme darstellt, außer natürlich bei starker Verkalkung. Die selbstexpandierende Core-Valve-Prothese führt häufiger zu PVL und SM-Abhängigkeit, allerdings ist sie bei starker Verkalkung oder kleinem Klappenring zu bevorzugen. Der Zugang zu den Koronarostien ist naturgemäß bei der ballonexpandierenden Edwards-Prothese besser gewährleistet.
de Haan: Welche Patienten sind nicht geeignet für eine TAVI Prozedur?
Cribier: 2020 wurden in Frankreich 15.000 Personen, in Deutschland 25.000 Personen und in den USA 60.000 Personen mit TAVI versorgt. Insgesamt bisher weltweit mehr als 1,5 Millionen! Derzeit sind jüngere Personen unter 65 bzw. 75 Jahren sowie Patientinnen und Patienten mit stark verkalkten bikuspiden Aortenklappen oder mit abnorm klappennahen Koronarostien nicht für eine TAVI geeignet, sondern für eine Klappenoperation. Valve-in-Valve-Prozeduren sind nach TAVI genauso möglich wie nach Bioprothesen-OP.
de Haan: TAVI oder Chirurgie – wie hoch ist das Risiko für Patientinnen und Patienten?
Cribier: In den letzten Jahren hatten wir hier in Rouen 5–15 Prozeduren pro Woche, eine ziemlich sichere Routine: transfemoraler Zugang, Lokalanästhesie und keine allgemeine Narkose, kein periprozedurales Echo mehr und arterielles Katheterverschlusssystem. In der Regel werden die Patientinnen und Patienten nach ein bis zwei Tagen entlassen. Ein herzchirurgisches Stand-by wird nicht durchgeführt. Eine Switch TAVI/OP habe ich in all den Jahren einmal erlebt.
Die aktuelle Studienlage von Eingriffen bei Hochrisiko- bis hin zu Niedrigrisikopatientinnen und -patienten hat in den letzten Jahren gezeigt, dass TAVI dem operativen Eingriff nicht unterlegen, ja oft überlegen ist. 2019 wurde das Patientenalter für einen TAVI-Eingriff in den USA auf 65 Jahre gesenkt. In Europa liegt es zurzeit noch bei 75 Jahren.