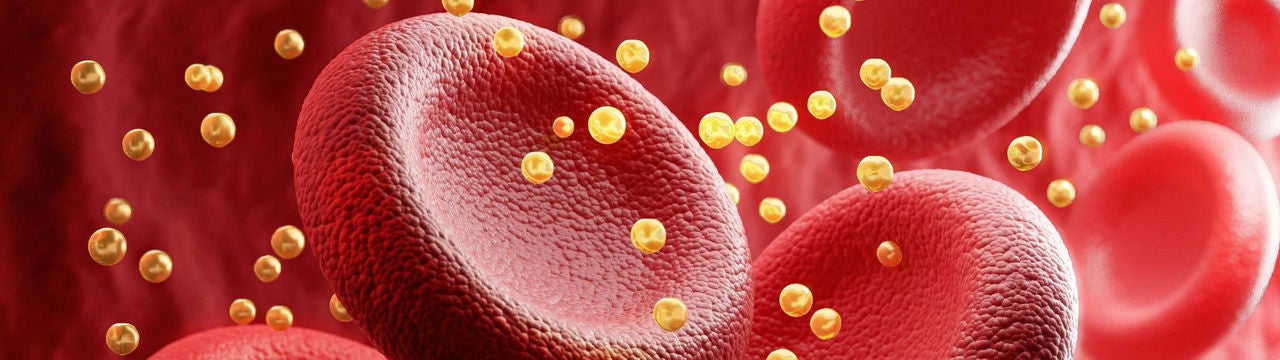Für das kardiovaskuläre Risiko ist nach aktuellem Verständnis der Cholesterin-Gehalt in Triglyzerid-reichen Lipoproteinen entscheidend. Die therapeutisch erzielte Reduktion der Anzahl atherogener Partikel – gemessen als Apolipoprotein B (Apo B) – erscheint als der entscheidende Faktor dafür, ob eine Triglyzeridsenkung auch mit einer kardiovaskulären Risikoreduktion einhergeht. Neue RNA-Interferenz-basierte Ansätze zur Triglyzeridsenkung richten sich gegen Apolipoprotein CIII (Apo CIII), Angiopoietin-ähnliches Protein 3 (ANGPTL3) und in der aktuellen Studie gegen ANGPTL4. Für diese Therapieziele konnte in genetischen Analysen von Individuen mit Loss-of-Function-Varianten gezeigt werden, dass diese ein reduziertes kardiovaskuläres Risiko aufweisen. Medikamente, welche sich gegen Apo CIII und ANGPTL3 richten, sind bereits zugelassen: Volanesorsen in Europa zur Behandlung des familiären Chylomikronämie-Syndroms (FCS) und der monoklonale Antikörper Evinacumab bei homozygoter familiärer Hypercholesterinämie. Beide Erkrankungen sind selten, und sowohl die Applikationsart (einmal monatlich intravenös bei Evinacumab) als auch Nebenwirkungen (z. B. Thrombozytopenie unter Volanesorsen bei FCS, Reizung an der Injektionsstelle) limitieren den breiteren Einsatz.
Die Entwicklung ANGPTL4-inhibierender Therapien war aufgrund negativer Signale aus Maus-Modellen verzögert. ANGPTL4 erscheint als vielversprechendes Therapieziel, da genetische Loss-of-Function-Varianten nicht nur mit einem reduzierten kardiovaskulären Risiko, sondern auch mit einem verringerten Risiko für Diabetes einhergehen. Es ist noch unbekannt, ob die Hemmung der Therapieziele Apo CIII, ANGPTL3 oder ANGPTL4 mit einer Reduktion des kardiovaskulären Risikos einhergeht. Die Effekte der einzelnen Medikamente auf die Lipidfraktionen unterscheiden sich: Während alle Wirkstoffe die Triglyzeride stark senken, zeigen sich bei Apo-CIII- und ANGPTL4-Inhibition keine wesentlichen Veränderungen im LDL-Cholesterin, während die ANGPTL3-Inhibition mit deutlichen LDL-C-Senkungen einhergeht. HDL-Cholesterin steigt unter Apo-CIII- und ANGPTL4-Inhibition, sinkt jedoch unter ANGPTL3-Hemmung. Der HbA1c steigt unter Apo-CIII- und ANGPTL3-Hemmung, bleibt aber unter MAR001 unbeeinflusst. Bei moderater Hypertriglyzeridämie wird Apo B durch Apo-CIII- und ANGPTL3-Inhibition gesenkt.
Die Studie von Cummings et al. liefert wichtige neue Erkenntnisse zur Sicherheit der ANGPTL4-Inhibition. Die Einschätzung eines potentiellen kardiovaskulären Nutzens dieser Therapie wird jedoch wesentlich durch das Fehlen von Apo-B-Daten limitiert. Das Forschungsteam berichtet über Veränderungen im Non-HDL-Cholesterin und Remnant-Cholesterin. Jedoch scheint das Non-HDL-Cholesterin möglicherweise hier nicht das Apo B zu repräsentieren, da die Non-HDL-Cholesterin-Senkung primär durch die HDL-Cholesterin-Steigerung bedingt war, und die verwendete Definition für Remnant-Cholesterin unüblich war, sodass auch der Rückgang des Remnant-Cholesterins nur schwer hinsichtlich der Bedeutung für eine kardiovaskuläre Risikoreduktion einzuschätzen ist.
Zusammenfassend liefert die Arbeit von Cummings et al. wichtige genetische und klinische Daten zur Sicherheit der Hemmung einer neuen Zielstruktur, dem ANGPTL4, beim Menschen. Zukünftige Studien werden zeigen müssen, ob durch die Hemmung von ANGPTL4 auch ein kardiovaskulärer Nutzen erzielt werden kann. In genetischen Studien sowie bei Primaten wurde unter ANGPTL4-Inhibition eine Apo-B-Senkung beobachtet. Sollte sich dies auch beim Menschen bestätigen, könnte die ANGPTL4-Hemmung ähnlich vielversprechend sein wie die Inhibition von Apo CIII und ANGPTL3 – möglicherweise mit zusätzlichen metabolischen Vorteilen. Die Ergebnisse von Cummings et al. rechtfertigen in jedem Fall eine Weiterentwicklung im Rahmen klinischer Studien.