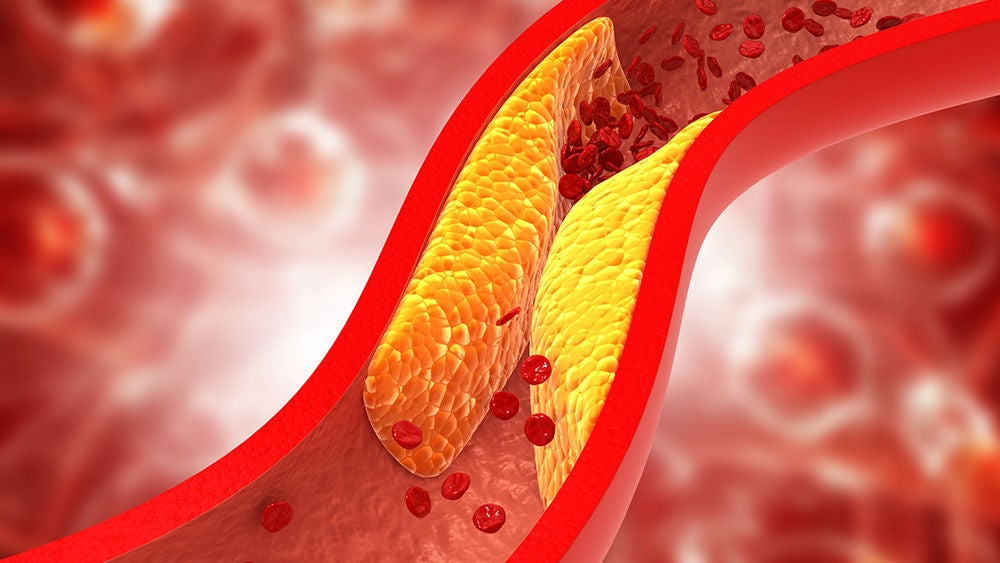Ein gesundheitsbewusster Lebensstil trägt entscheidend zur Prävention und Behandlung der koronaren Herzkrankheit bei. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt mindestens 150 Minuten moderate körperliche Aktivität oder 75 Minuten intensive Aktivität pro Woche, idealerweise verteilt auf mehrere Tage. Somit tragen 20 bis 30 Minuten zügiges Gehen schon einen großen Teil zum Schutz vor KHK bei. Mindestens genauso wichtig ist eine ausgewogene Ernährung. „Wir empfehlen hier die sogenannte mediterrane Kost, die aus viel Gemüse, Olivenöl, Fisch, Kräutern und Hülsenfrüchten besteht“, so Professor Haghikia. Der hohe Gehalt an gesunden Fetten und Ballaststoffen schützt nicht nur das Herz, sondern senkt auch das Risiko für Diabetes und bestimmte Krebsarten.
Der endgültige Rauchstopp, Gewichtsreduktion bei Übergewicht und Blutdruckregulierung bei erhöhten Werten sind drei weitere Faktoren, die die Entstehung einer koronaren Herzkrankheit verhindern können. „Darüber hinaus fördern stressreduzierende Maßnahmen sowie mindestens sieben Stunden Schlaf pro Nacht die kardiovaskuläre Gesundheit“, so Professor Haghikia.